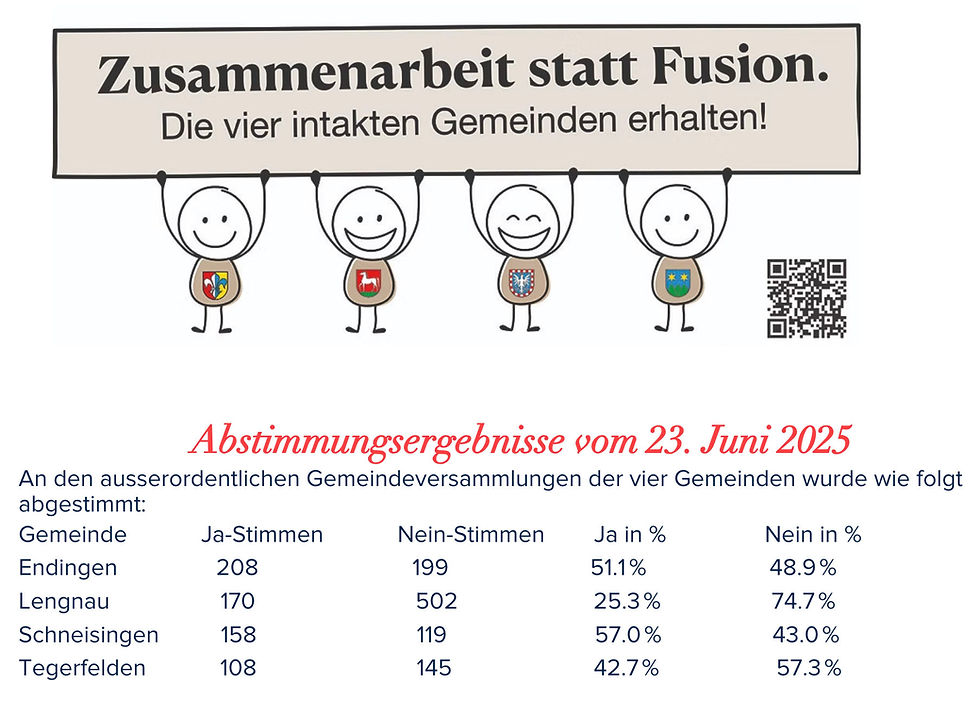Am Parteitag der SVP Aargau standen die zwei nationalen Abstimmungsvorlagen zur Debatte, über die am 30. November abgestimmt wird. Dabei hatten die befürwortenden Referenten einen schweren Stand.
Service-citoyen-Initiative
Nationalrat Beat Flach von der GLP empfahl mit einer anschaulichen Präsentation der Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz» (Service-citoyen-Initiative) zuzustimmen. Entschieden dagegen stellte sich Nationalrätin Stefanie Heimgartner von der SVP. Sie ging als klare Siegerin von der Bühne. Die Vorlage wurde mit 127 : 2 verworfen.
Die wehrdiensterprobte Stefanie Heimgartner befürchtet einer Schwächung der Armee. Die Schweizer Wehrpflicht würde weiter ausgehöhlt, indem die fähigsten Personen aus den sicherheitsrelevanten Bereichen abgezogen würden und gleichzeitig würde durch den Wegfall der Wahlfreiheit der Zivildienst geschwächt.
Zudem wäre der Verwaltungsaufwand durch einen riesigen neuen Verwaltungsapparat unverhältnismässig hoch und ohne spürbare Vorteile für die Sicherheit.
Zu hohen Mehrkosten führe unter anderem auch die Verdoppelung der Ausgaben für den Erwerbsersatz von ca. 800 Mio. auf ca. 1,6 Mrd. Franken sowie die Militärversicherung von ca. 160 Mio. auf ca. 320 Mio. Franken.
Auch die Unternehmen würden mehr belastet, weil die Verdoppelung der Dienstpflichtigen zu einem Mangel an Arbeitskräften führen und Unternehmen durch zusätzliche Kosten für Stellvertretungen, Überstunden und Produktionsausfälle belasten würden.
Keine Stimme für die Erbschaftssteuer-Initiative
Noch deutlicher, mit 128 : 0, wurde die Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik», bekannt als «Erbschaftssteuer-Initiative» abgelehnt. Meli De Fabro, Präsidentin der JUSO Aargau, stellte sich mutig gegen die im Saal vorherrschende Meinung, konnte jedoch gegen die Argumente von Nationalrat Thomas Burgherr (SVP), nichts ausrichten. Dieser verurteilte das Ansinnen der JUSO als unbedarft und gefährlich für unseren Wohlstand. Deshalb sei es unverantwortlich, dass die Führung der SP Schweiz diese Initiative ihrer Jugendorganisation unterstützt.
Die gutbesuchte Versammlung in der Rietwise Lengnau unter der Leitung von Parteipräsident und Nationalrat Andreas Glarner wurde von der einheimischen Musikgesellschaft mit einem brillanten Konzert eröffnet. Wohlwollend zur Kenntnis genommen wurden auch der durch Gemeindeammann Viktor Jetzer von der Gemeinde offerierte «Kaffee-avec» sowie die tadellose Organisation der SVP Lengnau.

Zum traditionellen Parteitag vor eidg. Abstimmungen lud die SVP Bezirk Zurzach am 11. September auf den Festplatz in Unterlengnau ein. Sie durfte am Vorabend des grossen Jubiläumsfestes des Feuerwehrvereins Lengnau dessen Inftrastruktur benutzen.
Nebst der Gelegenheit zum geselligen Beisammensein und zum persönlichen Meinungsaustausch ging es inhaltlich um Informationen zu den Abstimmungen vom 28. September. Beide Vorlagen, der Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften sowie das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz), wurden von Nationalrat Christoph Riner, Zeihen, erläutert.
Aus regionaler Sicht interessierten die Informationen zur Verkehrserschliessung Zurzibiet von Michael Mäder, Gemeindeammann Döttingen, sowie die ersten Erfahrungen von Hanspeter Suter, Lengnau, als Zurzibieter Vertreter im Grossen Rat.

Bezirksparteitag in der Scheune von Gemeindeammann Viktor Jetzer

Michael Mäder (sitzend), Gemeindeammann von Döttingen und Referent, Bezirksparteipräsident und Grossrat Hansjörg Erne sowie am Rednerpult Nationalrat Christoph Riner.